Spezielle Themen
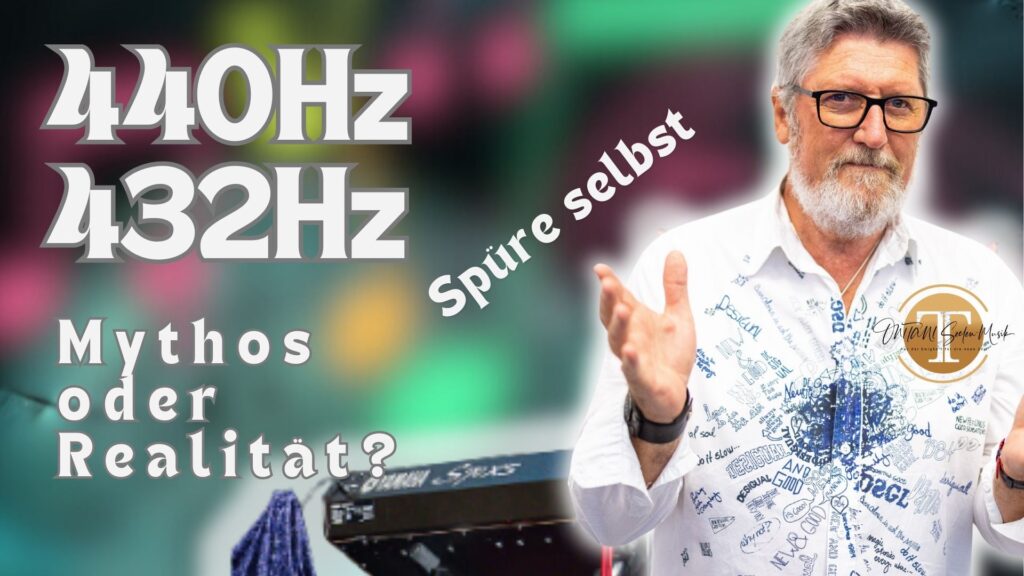
432Hz – 440Hz. Mythos oder Realität? Spüre selbst.
Tino von Onitani 2025
Die Kontroverse um die Stimmung: 440 Hz vs. 432 Hz
Die Frage, auf welche Frequenz der Kammerton A gestimmt werden soll, ist weit mehr als nur eine technische Debatte unter Musikern und Toningenieuren. Die Kontroverse um 440 Hz und 432 Hz hat sich zu einer vielschichtigen Diskussion entwickelt, die von historischen Fakten und physikalischen Prinzipien bis hin zu esoterischen Überzeugungen und Verschwörungstheorien reicht. Während 440 Hz der international anerkannte Standard ist, behaupten Befürworter von 432 Hz, dass diese Frequenz eine tiefere, harmonischere und sogar heilende Wirkung auf den Menschen hat.
- Die historische Entwicklung des Kammertons A
Um die Kontroverse zu verstehen, ist ein Blick auf die Geschichte der musikalischen Stimmung unerlässlich. Der Kammerton, also die Tonhöhe, nach der alle Instrumente eines Orchesters oder Ensembles gestimmt werden, war lange Zeit alles andere als standardisiert.
* Vor der Standardisierung:
In der Barockzeit und davor gab es keine einheitliche Stimmung. Die Tonhöhe konnte von Stadt zu Stadt, von Kirche zu Kirche und sogar von Orgel zu Orgel variieren. Musiker passten sich an das jeweilige Instrument an. Dies führte zu einer großen Bandbreite an Tonhöhen, die von etwa 380 Hz bis über 460 Hz reichte.
* Der Anstieg der Tonhöhe:
Im 19. Jahrhundert begann eine Tendenz zur „Pitch Inflation“, also einem Anstieg der Tonhöhe. Musiker und Instrumentenbauer stellten fest, dass eine höhere Stimmung einen helleren, brillanteren Klang erzeugte. Dies führte zu einem ständigen Wettlauf um höhere Frequenzen, was für Sänger und bestimmte Instrumente wie Streichinstrumente und Holzbläser zunehmend problematisch wurde.
* Der französische Diapason Normal:
Als Reaktion auf dieses Chaos wurde 1859 in Frankreich der „diapason normal“ eingeführt, der den Kammerton A auf 435 Hz festlegte. Dies war ein bedeutender Schritt in Richtung Standardisierung.
* Die Konferenzen und der Weg zu 440 Hz:
In den folgenden Jahrzehnten gab es weitere internationale Konferenzen. Eine Konferenz in Wien im Jahr 1885 schlug vor, A auf 440 Hz zu stimmen, um den Klang heller zu machen. Die entscheidende Entwicklung fand jedoch in den 1920er und 1930er Jahren statt. 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde in London eine internationale Konferenz abgehalten, bei der der Standard von A = 440 Hz von der British Standards Institution offiziell empfohlen wurde. Dieser Standard wurde später 1955 von der International Organization for Standardization (ISO) als ISO 16:1955 bestätigt und 1975 erneut bekräftigt.
- 440 Hz: Der wissenschaftliche und industrielle Standard
Die Entscheidung für 440 Hz hatte pragmatische Gründe. Sie bot einen Kompromiss zwischen der historischen Praxis und den klanglichen Präferenzen des 20. Jahrhunderts.
* Physikalische Messbarkeit:
Die Frequenz von 440 Hz ist eine glatte Zahl, die sich leicht elektronisch erzeugen und messen lässt. Dies war besonders wichtig für die aufkommende Funk- und Rundfunktechnik. Ab 1936 sendete die US-amerikanische Behörde National Bureau of Standards (heute NIST) ein 440-Hz-Signal, um Orchester bei der Stimmung zu unterstützen.
* Breite Akzeptanz:
Die Standardisierung auf 440 Hz ermöglichte eine globale Einheitlichkeit. Musiker konnten sicher sein, dass ihre Instrumente überall auf der Welt im Einklang waren, was internationale Tourneen, Aufnahmen und den Austausch von Musikern vereinfachte. Die meisten modernen Instrumente, vom Klavier bis zur Gitarre, sind auf diesen Standard ausgelegt.
- 432 Hz: Die esoterische und alternative Perspektive
Gegen den etablierten Standard von 440 Hz hat sich eine wachsende Gegenbewegung gebildet, die 432 Hz als die „wahre“ oder „natürliche“ Frequenz der Musik propagiert. Die Argumente für 432 Hz basieren auf einer Mischung aus historischen Interpretationen, numerologischer Symbolik und pseudowissenschaftlichen Behauptungen.
* Der „Verdi-Pitch“:
Ein häufiges Argument ist, dass der italienische Komponist Giuseppe Verdi den Kammerton A auf 432 Hz bevorzugte. Tatsächlich setzte sich Verdi in einem Brief für eine tiefere Stimmung ein, um die Stimmen der Sänger zu schonen. Dies führte dazu, dass der „Verdi-Pitch“ oft mit A = 432 Hz in Verbindung gebracht wird.
* Pythagoras und die Harmonie der Sphären:
Anhänger der 432-Hz-Stimmung verknüpfen sie oft mit antiken Kulturen und Denkern. Sie behaupten, dass das antike Griechenland, Ägypten und andere Zivilisationen ihre Musik auf 432 Hz stimmten. Der griechische Philosoph Pythagoras, der das Konzept der „Harmonie der Sphären“ lehrte, wird oft in diesem Zusammenhang genannt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass der Begriff „Hertz“ (Schwingungen pro Sekunde) erst im 20. Jahrhundert von Heinrich Hertz geprägt wurde. Antike Musiker arbeiteten mit Verhältnissen, nicht mit absoluten Frequenzen. Die Behauptung, dass Pythagoras‘ Monochord auf 432 Hz gestimmt war, ist historisch nicht belegbar.
* Numerologische und esoterische Verbindungen:
Ein zentrales Argument ist die numerologische Resonanz von 432 Hz. Die Zahl 432 ist ein Vielfaches von 9 (4+3+2 = 9) und wird oft mit kosmischen Zyklen und Proportionen in Verbindung gebracht. Es wird argumentiert, dass 432 Hz mit der Schumann-Resonanz (den natürlichen elektromagnetischen Schwingungen der Erde, die bei durchschnittlich 7,83 Hz liegen) oder dem Herzschlag des Menschen in Resonanz steht. Diese Verbindungen werden oft durch komplexe mathematische Berechnungen und Verhältnisse hergestellt, die in der Praxis jedoch nicht standhalten. Zum Beispiel ist die Schumann-Resonanz nicht konstant 8 Hz, und der menschliche Herzschlag ist variabel.
* Die Goebbels-Verschwörungstheorie:
Eine der hartnäckigsten und am weitesten verbreiteten Verschwörungstheorien besagt, dass die Nazis unter Joseph Goebbels die Standardstimmung auf 440 Hz festgelegt haben, um die Bevölkerung zu manipulieren. Die Behauptung ist, dass 440 Hz Aggression und Nervosität fördert und die Menschen leichter kontrollierbar macht, während 432 Hz eine beruhigende, harmonisierende Wirkung hat. Diese Behauptung ist historisch nicht haltbar. Wie oben beschrieben, wurde die 440-Hz-Stimmung lange vor der NS-Zeit diskutiert und von internationalen Gremien empfohlen. Es gibt keine Belege dafür, dass Goebbels an der Londoner Konferenz von 1939 teilnahm oder diese initiierte, und die Idee, dass eine Frequenz auf diese Weise die gesamte Bevölkerung steuern könnte, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.
- Die wissenschaftliche Perspektive
Aus wissenschaftlicher und musikwissenschaftlicher Sicht gibt es kaum empirische Belege für die überlegenen Eigenschaften von 432 Hz.
* Physikalische Wahrnehmung:
Die Differenz zwischen A = 440 Hz und A = 432 Hz beträgt etwa 31,7 Cent, was weniger als ein Drittel eines Halbtons ist. Für die meisten Menschen ist der Unterschied in der Tonhöhe kaum wahrnehmbar.
* Wissenschaftliche Studien:
Eine Studie, die 2019 im Fachmagazin Journal of Complementary and Alternative Medicine veröffentlicht wurde, untersuchte die Auswirkungen von Musik, die auf 440 Hz und 432 Hz gestimmt war, auf vitale Parameter (Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz) und Wahrnehmungen bei 33 Freiwilligen. Die Studie zeigte, dass Musik auf 432 Hz mit einem geringfügigen, aber signifikanten Rückgang der Herzfrequenz verbunden war. Die Probanden berichteten auch über eine höhere Zufriedenheit und Konzentration bei der 432-Hz-Musik. Die Autoren merkten jedoch an, dass die Stichprobengröße klein war und weitere Forschung erforderlich ist. Die Ergebnisse sind nicht ausreichend, um weitreichende Schlussfolgerungen über „heilende“ oder „schädliche“ Wirkungen zu ziehen.
* Maria Renold’s Experimente:
Eine oft zitierte Quelle für die positiven Effekte von 432 Hz ist die Arbeit der Musikpädagogin Maria Renold. Sie führte in den 1980er Jahren Experimente durch, bei denen sie Probanden Töne in verschiedenen Stimmungen vorspielte. Ihre Ergebnisse, die sie in ihrem Buch Intervals, Scales, Tones veröffentlichte, zeigten, dass die Mehrheit der Hörer die auf A = 432 Hz gestimmten Töne als angenehmer, klarer und weniger „aggressiv“ empfand als die auf 440 Hz gestimmten. Ihre Forschung war jedoch nicht peer-reviewed und die Methodik wird von Wissenschaftlern kritisiert.
- Der Klangunterschied: Subjektive Wahrnehmung
Obwohl die physikalische Differenz gering ist, kann der subjektive Höreindruck variieren.
* Wärme und Sanftheit (432 Hz):
Befürworter beschreiben den Klang von 432-Hz-Musik oft als weicher, wärmer, entspannender und natürlicher. Dies könnte psychologische Gründe haben: eine leicht tiefere Stimmung wird oft mit einem entspannteren Gefühl assoziiert.
* Helligkeit und Brillanz (440 Hz):
440-Hz-Musik wird als heller, schärfer und präsenter wahrgenommen. Dies ist der Klang, den die meisten Menschen durch Rundfunk, Popmusik und klassische Aufnahmen gewohnt sind.
- Fazit
Die Kontroverse zwischen 440 Hz und 432 Hz ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Standards, historische Entwicklungen und esoterische Überzeugungen ineinandergreifen können.
* Der Konsens in der Musikwelt:
Der überwiegende Großteil der professionellen Musiker, Orchester und Komponisten arbeitet heute mit dem Standard von 440 Hz, oder in einigen Regionen und bei bestimmten Orchestern sogar leicht höher (z.B. A = 442 Hz in Teilen Europas), um einen brillanteren Klang zu erzielen.
* Die Pseudowissenschaft:
Die Behauptungen über die heilenden Eigenschaften von 432 Hz und die Verschwörungstheorien um Goebbels sind wissenschaftlich und historisch nicht haltbar.
* Die subjektive Erfahrung:
Trotzdem ist es unbestreitbar, dass die Wahrnehmung von Musik eine zutiefst subjektive Erfahrung ist. Wenn ein Hörer oder Musiker eine tiefere Stimmung als angenehmer oder beruhigender empfindet, ist das eine gültige persönliche Erfahrung. Die Präferenz für 432 Hz mag weniger auf physikalischen oder esoterischen „Fakten“ beruhen, sondern vielmehr auf psychologischer und ästhetischer Wahrnehmung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 440 Hz der etablierte, historisch entwickelte und wissenschaftlich fundierte Standard ist, während 432 Hz eine alternative Stimmung darstellt, die von einer Nischengemeinschaft aus esoterischen, numerologischen und subjektiven klanglichen Gründen bevorzugt wird.
Die „Wahrheit“ liegt letztendlich im Ohr des Hörers.
Spüre selbst: 432 – 440 – 448
Musikauszug aus: „Von Leere und Vertrauen“ Tino von Onitani
432 Hz
440 Hz
448Hz
Hier suchen.
Hier Newsletteranmelden

Energieausgleich
Bankdaten
ONITANI KLG
B. & T. Mosca-Schütz
Hauptstrasse 13
CH-4556 Burgäschi
UID/MWST: CHE-114.665.805
CHF
Post: CH03 0900 0000 8516 9656 4
BIC/Swift Code: POFICHBEXXX
Raiffeisen: CH18 8080 8008 0333 5324 9
BIC/Swift Code: RAIFCH22938
EUR
Raiffeisen: CH73 8080 8003 6391 8891 8
BIC/Swift Code: RAIFCH22938
Kommende Events
-
14 marWorkshop Seelengesang mit Bettina 14.03.26
-
09 aprBEWUSST SEINS TAGE SOLOTHURN
-
22 mayLebenskraft Kongress

